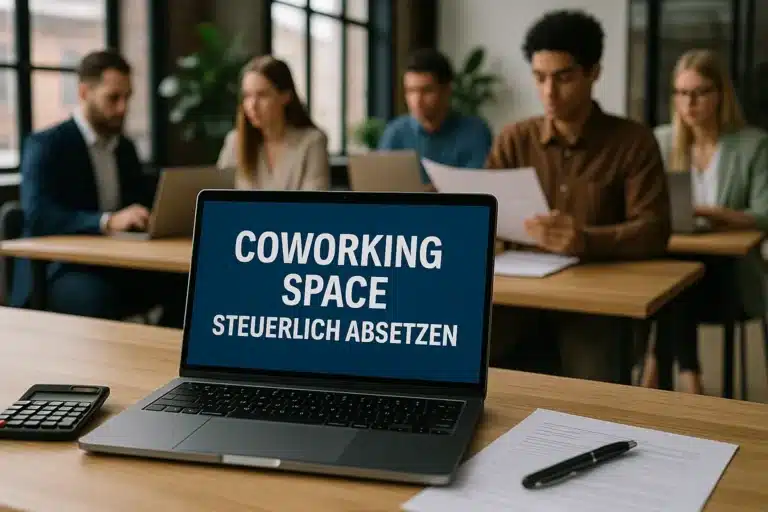Die Grundsteuerreform 2025 bringt für Unternehmen mit Immobilienbesitz weitreichende Veränderungen. Neue Bewertungsverfahren, unterschiedliche regionale Modelle und erweiterte Deklarationspflichten erhöhen die Komplexität und den Verwaltungsaufwand. Zudem können sich durch die Neubewertung je nach Lage und Nutzung der Grundstücke stark unterschiedliche Steuerbelastungen ergeben. Eine fundierte Auseinandersetzung mit den neuen Regelungen ist unerlässlich, um finanzielle Risiken zu vermeiden und geeignete Maßnahmen rechtzeitig einzuleiten.
Unternehmen im Fokus der Grundsteuerreform
Die Reform der Grundsteuer in Deutschland stellt eine tiefgreifende Veränderung dar, die erhebliche Auswirkungen auf Unternehmen mit Immobilienbesitz oder langfristig gepachteten Grundstücken haben kann. Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2018 wurde der Gesetzgeber verpflichtet, die bisherigen Bewertungsgrundlagen zu überarbeiten, da diese gegen den Gleichheitsgrundsatz verstießen. Seit dem 1. Januar 2025 wird die neue Berechnungsmethode bundesweit angewendet. Damit ergeben sich neue Bemessungsgrundlagen, die je nach Standort und Nutzung zu deutlich abweichenden Steuerbeträgen führen können.
Unternehmen müssen die neuen steuerlichen Belastungen kalkulieren und deren betriebswirtschaftliche Folgen umfassend bewerten. Die Auswirkungen betreffen sowohl die Liquiditätsplanung als auch potenzielle Anpassungen von Mietverträgen, sofern Grundsteuer umgelegt wird. Zugleich entstehen neue Anforderungen an die steuerliche Deklaration, insbesondere durch die geänderten Bewertungsverfahren auf Basis des sogenannten Bundesmodells oder landesspezifischer Abweichungen.
Eine strukturierte Analyse ist erforderlich, um aus der Reform resultierende Risiken frühzeitig zu erkennen und Handlungsspielräume sinnvoll zu nutzen.
Eckdaten der Reform im Unternehmenskontext
Die Grundsteuerreform basiert auf dem sogenannten Bundesmodell, das in den meisten Bundesländern zur Anwendung kommt. Ausnahmen bilden unter anderem Bayern, Baden-Württemberg und Hessen, die eigene Modelle eingeführt haben. Für Unternehmen bedeutet dies eine erhöhte Komplexität, insbesondere bei bundesweit verteiltem Immobilienbestand. Die neue Bemessungsgrundlage ergibt sich aus dem Grundsteuerwert, dem Steuermessbetrag und dem Hebesatz der jeweiligen Gemeinde.
Die wichtigsten Änderungen im Überblick:
- Grundsteuerwert ersetzt die bisherige Einheitsbewertung
- Ertragswertverfahren bei betrieblich genutzten Immobilien
- Bodenrichtwerte und Nettokaltmiete fließen in die Bewertung ein
- Stichtag 1. Januar 2022 für alle Angaben zur Neubewertung
- Neue Feststellungserklärungen waren bis 31. Januar 2023 abzugeben
- Grundstücke und Gebäude werden je nach Lage und Nutzung unterschiedlich bewertet
- Kommunale Hebesätze führen zu regional variierender Steuerbelastung
- Höherer Verwaltungsaufwand für Unternehmen mit bundesweitem Immobilienbestand
Für Unternehmen ergibt sich nicht nur eine mögliche Veränderung der jährlichen Grundsteuerzahlung, sondern auch ein erhöhter Aufwand in der steuerlichen Verwaltung und eine Anpassung bestehender Finanz- und Investitionsrechnungen.
Diese Änderungen führen dazu, dass Grundstücke und Gebäude je nach Lage und Nutzung stark abweichend bewertet werden.
Mehrbelastung oder Entlastung?
Die Neubewertung kann für Unternehmen mit Grundstücken in attraktiven Lagen zu erheblichen Mehrbelastungen führen. Der verstärkte Einbezug von Bodenrichtwerten und realen Ertragswerten wirkt sich insbesondere in Ballungsräumen deutlich auf die Höhe der Grundsteuer aus. Gleichzeitig entstehen in strukturschwachen Regionen potenzielle Entlastungen. Die Hebesätze bleiben weiterhin kommunale Entscheidungssache, was zu einer zusätzlichen regionalen Divergenz führt.
Im Vergleich zu den bisherigen Einheitswerten ergeben sich durch die neuen Bewertungsansätze folgende Unterschiede:
| Bewertungsfaktor | Alt (Einheitswert) | Neu (Grundsteuerwert) |
| Grundlage | Werte aus 1964/1935 | Aktuelle Marktverhältnisse (Stichtag 01.01.2022) |
| Lagefaktor | Kaum differenziert | Deutlich lageabhängig, starke Differenzierung nach Region |
| Ertragsorientierung | Nur eingeschränkt berücksichtigt | Vollständige Integration des Ertragswertverfahrens |
| Aktualisierung | Sehr selten, meist Jahrzehnte | Regelmäßige Neubewertung vorgesehen |
| Bewertungsverfahren | Einheitswertverfahren | Ertragswert- oder Sachwertverfahren (je nach Objekttyp) |
Die Folge sind teilweise drastisch abweichende Steuerbeträge, die betriebliche Budgets spürbar beeinflussen. Insbesondere für filialisierte Unternehmen oder Gewerbebetriebe mit großen Flächen in Innenstadtlagen entsteht Handlungsbedarf, da die neuen Werte zu einer strukturellen Umverteilung der Steuerlast führen. Dies kann auch strategische Entscheidungen über den Verbleib oder die Verlagerung von Standorten beeinflussen.
Handlungsstrategien zur Risikominimierung
Um auf die neuen Anforderungen der Grundsteuerreform angemessen zu reagieren, sollten Unternehmen proaktiv Maßnahmen zur Anpassung ihrer Prozesse und Strukturen einleiten. Eine frühzeitige Analyse der potenziellen Steuerbelastung und der damit verbundenen Auswirkungen auf den Cashflow ist unerlässlich. Zudem besteht die Möglichkeit, betriebswirtschaftliche Steuerungsinstrumente gezielt einzusetzen, um finanzielle Belastungen abzufedern.
Empfehlenswerte Maßnahmen im Überblick:
- Prüfung der Feststellungsbescheide auf Fehler oder Abweichungen
- Standortbezogene Steueranalyse zur Ermittlung regionaler Unterschiede
- Optimierung der Nutzungsart zur Minderung der Ertragswerte
- Verhandlungen mit Mietern über Umlagefähigkeit
- Anpassung der Investitionsstrategie bei Neubauten oder Zukäufen
Darüber hinaus sollten Unternehmen prüfen, ob sich durch Umstrukturierungen innerhalb des Immobilienportfolios steuerliche Vorteile erzielen lassen. Dies kann etwa durch Verlagerung von Nutzungsarten oder durch Sale-and-Lease-Back-Konstruktionen erfolgen. Auch die Einbindung steuerlicher Berater zur rechtssicheren Bewertung und Einspruchsführung gegen fehlerhafte Bescheide ist sinnvoll.
Langfristige Anpassung der Immobilienstrategie
Die Grundsteuerreform verändert die kurzfristige Steuerbelastung und wirkt sich langfristig auf das strategische Immobilienmanagement aus. Standortentscheidungen, Nutzungsoptimierungen und interne Verrechnungen gewinnen an Bedeutung. Unternehmen, die auf präzise Immobilienbewertungen und belastbare Kostenprognosen angewiesen sind, müssen ihre Controlling- und Reportingprozesse anpassen.
Die Einführung einer transparenten Kostenstruktur und die kontinuierliche Überwachung kommunaler Hebesätze gehören künftig zu den zentralen Aufgaben des betrieblichen Rechnungswesens. Gleichzeitig sollte eine enge Zusammenarbeit zwischen Steuerabteilung, Controlling und Facility Management etabliert werden, um datengestützte Entscheidungen zu ermöglichen.
Die Grundsteuer wird zu einem noch relevanteren Faktor im Rahmen von Standortanalysen, insbesondere bei Expansions- oder Konsolidierungsstrategien.
Durch eine systematische Einbindung der Grundsteuer in das finanzielle Risikomanagement entstehen neue Potenziale zur Effizienzsteigerung. Wer frühzeitig reagiert, sichert sich Vorteile bei der langfristigen Planung und schützt das Unternehmen vor unerwarteten Belastungen durch nachträgliche Steueranpassungen oder kommunale Steuererhöhungen.